
"Bauen-wohnen-leben": Seit 30 Jahren fördert die Schwäbisch Hall-Stiftung den Diskurs rund um diese drei Themen und steht dabei in engem Kontakt mit Wissenschaft, Politik und Praxis. Die gemeinnützige Stiftung der Bausparkasse wurde bewusst unabhängig vom Geschäftsbetrieb gegründet, um sich frei am gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Austausch zu beteiligen.
Think-Tank des Unternehmens
"Die Stiftung ist gewissermaßen unser Think-Tank zu allen Themen rund um Bauen, Wohnen und Leben. Hier tauschen wir uns mit Wissenschaftlern, Politikern und Praktikern aus, nehmen Meinungen und Trends auf und bringen uns aktiv in die öffentliche Diskussion ein."
Die Stiftung
- Sitz: Schwäbisch Hall
- Stiftung durch die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
- 1995 Eintragung in das Stifterverzeichnis des Regierungspräsidiums Stuttgart
Unsere Stiftungsbroschüre
Mehr über die Arbeit der Stiftung erfahren Sie in unseren Stiftungsbroschüren.
Einblicke in unsere Fachexkursionen
Akkordeon öffnen/schließen Fachexkursion 2025: Strukturelle Umbrüche/Aufbrüche der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025
Die diesjährige Fachexkursion führt nach Chemnitz, die Kulturhauptstadt Europas 2025. Die Stadt hat in ihrer Geschichte
einen vielfältigen Wandel durchlebt und gestaltet – von der einstigen Industriemetropole im 19. und 20. Jahrhundert zu Karl-Marx-Stadt als Musterstadt des Sozialismus bis hin zur Neuerfindung nach der Wende und nun als Europäische Kulturhauptstadt. Dieser Wandel ist im Stadtbild und an vielen Objekten sichtbar und erlebbar. Mit der Exkursion bieten wir die Möglichkeiten,
die eindrucksvollen Zeugnisse der Transformation unter sach- und fachkundiger Führung in Augenschein zu nehmen.
Akkordeon öffnen/schließen Fachexkursion 2024: Suffizientes und nachhaltiges Bauen in Augsburg und München
Fachexkursion nach Augsburg und München: Suffiziente und nachhaltige (Wohn-)Bauprojekte
Ist Nachhaltigkeit zwingend mit Verzicht verbunden? Wie gelingt es uns, lebenswerte Städte zu schaffen und gleichzeitig einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten? Welche Best-Practice Lösungen sind bereits umgesetzt worden und können für Projekte andernorts Orientierung geben?
Auf diese und andere Fragen im Kontext des nachhaltigen Stadtumbaus hat die städtebauliche Exkursion im Jahr 2024 Antworten gegeben und dabei unter fachlicher Begleitung eine Reihe von spannenden und beispielhaften Projekten in Augsburg und München in Augenschein genommen.
 Fachexkursion 2024 der Schwäbisch Hall-Stiftung "bauen-wohnen-leben"
Fachexkursion 2024 der Schwäbisch Hall-Stiftung "bauen-wohnen-leben" Die sechs Vorzeige-Projekte im Überblick
Akkordeon öffnen/schließen Führung in der WWK ARENA des FC Augsburg – Klimaschutz am Beispiel Fußball
Die WWK ARENA wird nicht nur mit Strom aus regenerativen Energien versorgt, sondern auch CO2-neutral beheizt und gekühlt. Damit ist es eines der wenigen CO2-neutralen Stadien weltweit und ein absoluter Vorreiter. Nach einer spannenden Führung durch das Stadion, stellte Jörn Seinsch, Nachhaltigkeitsmanagement FC Augsburg, die Nachhaltigkeitsstrategie des Vereins und die vielen ökologischen und sozialen Projekte vor, für die der FC Augsburg sich engagiert.
Akkordeon öffnen/schließen Technische Hochschule Augsburg: Nachhaltiges Bauen in Hochgeschwindigkeit
Der neue Modulbau der Technischen Hochschule Augsburg (THA) hatte schon nach vier Monaten Richtfest und zeigt damit, dass nachhaltiges Bauen und Schnelligkeit bestens vereinen lassen. Das Gebäude verfügt über ein begrüntes Dach und eine eigene Photovoltaik-Anlage. Prof. Dr.-Ing. Elisabeth Krön, Wissenschaftliche Leitung Institut für Bau und Immobilie (IBI)und THA_akademie, führte über das dicht bebaute Gelände des Hochschul-Campus und erklärte den Teilnehmenden, welche Herausforderungen sich bei einem Neubau in so kurzer Zeit auf limitierter Fläche ergeben. Außerdem gab sie einen Einblick, wie das New-Work-Konzept des Gebäudes für Angestellte der Hochschule und Studierende funktioniert.
Akkordeon öffnen/schließen „über_dacht“ am Beispiel McGraw-Graben in München-Giesing
Das Forschungsprojekt „über_dacht I Neue Standorte fürs Wohnen“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und der Universität Stuttgart untersucht noch kaum berücksichtigter Flächenreserven für die Nachverdichtung in Städten. Gerade mit Verkehrsflächenüberbauungen kann ohne neuen Baulandverbrauch nachverdichtet werden. Ein Teil des Projekts ist der McGraw-Graben in München, eine der Hauptverkehrsadern der Stadt. Aktuell wird untersucht, wie auf die bestehende Konstruktion doch ein „Deckel“ aufgebaut werden kann, sodass die Fläche darüber nutzbar gemacht wird. Dabei soll nicht nur neuer Wohnraum entstehen, sondern das Quartier insgesamt aufgewertet werden: durch mehr Grünflächen, Lärm- und Emissionsschutz, neue Fuß- und Radwege und neue Aufenthaltsorte für die Nachbarschaft.
Akkordeon öffnen/schließen Sanierungsgebiet München-Neuperlach
Vor rund 50 Jahren wurde das Viertel Neuperlach gebaut – jetzt wird es fit für die Zukunft gemacht. Ziele für die in die Jahre gekommenen Großwohnsiedlungen: energetische Sanierung, soziale Infrastruktur verbessern, Sonnenenergie nutzbar machen, Freiflächen und Orte der Begegnung schaffe. Während der Tour durchs Viertel wurde den Teilnehmenden neben dem Sanierungsplan auch ein bereits saniertes
Wohnhochhaus mit PV-Anlage und Dachbegrünung vorgestellt sowie die
Zwischennutzung „Shaere“ eines alten Bürogebäudes, in dem Kreative und eine Gemeinschaftsküche, die mit geretteten Lebensmitteln kocht, Platz finden.
Akkordeon öffnen/schließen Prinz-Eugen-Park
Die ehemalige Prinz-Eugen-Kaserne im Münchner Osten ist ein freigegebenes Militärgelände, auf dem heute der schonende Umgang mit Umwelt und Energie im Mittelpunkt stehen. Deshalb wurde in einem Teil des Prinz-Eugen-Parks eine ökologische Mustersiedlung in Holzbauweise mit fast 600 Wohnungen gebaut - die größte zusammenhängende Holzbausiedlung Deutschlands. Während der Führung durchs Quartier erklärte Claudia Neeser, Architektin und Stadtplanerin, Inhaberin von
guiding architects munich, dass die Holzbauten 12.000 Tonnen CO2 binden, die Dachflächen intensiv begrünt sind und die Grünflächen des Areals wertvolle Biotope für Vögel und Insekten sind – ein richtiges Vorzeigeprojekt.
Akkordeon öffnen/schließen „Einfach bauen“-Projekt: Parkplatzüberbauung am Dantebad (Dante I und Dante II)
Gerade in Ballungsgebieten ist es wohl eine der dringlichsten und wichtigsten Aufgaben, schnell neuen Wohnraum zu schaffen. Gute Beispiele dafür sind die Projekte Dante I und Dante II im Münchner Nordwesten – Dante I wurde in nur etwa einem Jahr gebaut. Durch die Überbauung von Parkplatzflächen wurden hier insgesamt etwa 100 Wohnungen geschaffen. So wird die bereits versiegelte Fläche mehrfach und optimal genutzt. Mit dem Architekten des Projekts, Dipl.- Ing. Sebastian Streck, Florian Nagler Architekten Gmbh, ging es bei der Führung sogar auf die begrünte Dachterrasse des Gebäudes Dante I, mit Blick über München und eigenen Hochbeeten für die Bewohnenden.
„Wohnraum in Ballungsgebieten in Kombination mit Nachhaltigkeit ist ein absolut zukunftskritisches Thema – es ist also sehr wichtig zu sehen, dass es in Städten wie München schon gute Beispiele gibt, wie das zu bewältigen ist.“
Wim Buesink, Geschäftsführer Schwäbisch Hall-Stiftung bauen-wohnen-leben

Akkordeon öffnen/schließen Fachexkursion 2023: Nachhaltiger Stadtumbau in urbanen Zentren
Fachexkursion ins Ruhrgebiet: Nachhaltiger Stadtumbau in urbanen Zentren
Knapper Wohnraum, hohe Quadratmeterpreise – gerade in urbanen Zentren suchen Menschen nach bezahlbaren Wohnungen. Gleichzeitig gilt es auch in der Stadt, die Anforderungen des Klima- und Naturschutzes zu berücksichtigen. Wie das gelingen kann, zeigte die städtebauliche Exkursion der Schwäbisch Hall-Stiftung „bauen-wohnen-leben“ zu beispielhaften Projekten im Ruhrgebiet.
Das Ruhrgebiet ist ein guter Ort, um zu zeigen, wie bestehende Flächenpotentiale in den Städten mit Ideen und Kreativität nachhaltig und effektiv genutzt werden.
 Reger Austausch herrschte zwischen den teilnehmenden Architekten, Stadtplanern und Politikern bei der Fachexkursion „bauen-wohnen-leben“ im Ruhrgebiet.
Reger Austausch herrschte zwischen den teilnehmenden Architekten, Stadtplanern und Politikern bei der Fachexkursion „bauen-wohnen-leben“ im Ruhrgebiet.
Vom Stahlwerk zur urbanen Oase mit modernem Stadtquartier
Zum Auftakt führte die Exkursion nach „Phoenix“, einer neuen Stadtlandschaft in Dortmund. Wo sich zur Jahrtausendwende noch ein voll funktionierendes Stahlwerk befand, ist inzwischen ein See mit Grünflächen sowie ein modernes Stadtquartier für wohnliche und gewerbliche Zwecke entstanden. Damit verbindet das Quartier wohnliche Bedarfe mit einem naturnahen und nachhaltigen Umfeld.
Renaturierung der Emscher-Region
Als eines der größten Umwelt- und Infrastrukturprojekte Europas umfasst der Emscher-Umbau den gesamten Hauptlauf des Flusses Emscher sowie ihre Nebenläufe. Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender Emschergenossenschaft und Lippeverband, betont die Einzigartigkeit dieses Projektes: „Planung, Bau und Betrieb sind bei diesem Projekt aus einer Hand, sodass wir durch kürzere Entscheidungswege schneller handeln können.“ Mit der bereits über 30 Jahre dauernden Umgestaltung wird die Emscher-Region mit Projekten weit über den Gewässerlauf hinaus aufgewertet und das Lebens- und Arbeitsumfeld der Menschen nachhaltig verändert.
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen in Essen und Bottrop
Die nächste Station führte in die ehemalige Kohle- und Stahlstadt Essen, die im Jahr 2017 als „Grüne Hauptstadt Europas - Essen 2017“ ausgezeichnet wurde. Simone Raskob, Beigeordnete der Stadt Essen, gab Einblicke, wie die Transformation von einer grauen Industrielandschaft zur drittgrünsten Stadt Deutschlands erfolgreich gestaltet werden kann. Dabei nimmt die Stadt Essen eine Vorbildfunktion ein, wie trotz schwieriger Haushaltslage der Wandel zu einer modernen, zukunftsfähigen und lebenswerten Stadt gelingt.
Den Abschluss der Tour bildete das Projekt InnovationCity Ruhr in Bottrop, das innovative Ideen und Lösungen entwickelt, wie den Herausforderungen des Klima- und Strukturwandels im urbanen Raum begegnet werden kann. Seit 2010 demonstriert das „Labor Bottrop“, wie ein klimagerechter Stadtumbau unter Berücksichtigung der Sicherung des Industriestandortes aussehen kann.
„Von beispielhaften Projekten auch andernorts lernen“
Die Schwäbisch Hall-Stiftung bietet Fachexkursionen dieser Art regelmäßig an: „Durch Veranstaltungen wie diese schaffen wir es, von beispielhaften Projekten auch andernorts zu lernen. Im Ruhrgebiet ist es vielerorts gelungen, einen nachhaltigen städtebaulichen Strukturwandel umzusetzen - das haben wir an einigen spannenden Beispielen gesehen“, verdeutlicht Wim Buesink, Geschäftsführer von „bauen-wohnen-leben“. Die Exkursion bietet Raum für den interdisziplinären Austausch zwischen Finanzbranche, Planern und der Politik.

Akkordeon öffnen/schließen Fachexkursion 2019: Innovative Leuchtturmprojekte: Bauen und Wohnen neu denken
Innovative Leuchtturmprojekte: Bauen und Wohnen neu denken
Welche Lösungen und neuen Entwicklungen gibt es für aktuelle Herausforderungen beim Bauen und Wohnen? Um diese Frage zu beantworten, trafen sich im Herbst 2019 insgesamt 37 Experten, darunter Architekten, Bausachverständige und Politiker. Auf dem Programm der Fachexkursion der Stiftung „bauen – wohnen – leben“ standen drei Beispielprojekte in Deutschland und den Niederlanden, die Einblicke in neue Verfahren und Technologien in Sachen Bauen und Wohnen geben.
Die Exkursion war eine rundum gelungene, kurzweilige und informative Fortbildung mit einer interdisziplinären Teilnehmergruppe von Finanziers, Investoren und Planern.
 Unterwegs auf Einladung der Stiftung „bauen - wohnen - leben“: Expertenrunde mit Vertretern von Kommunen, Städtetag, Architektenkammern, Wohnungsbauunternehmen, Finanzwirtschaft, wohnwirtschaftlichen Verbänden, Medien und der Wissenschaft
Unterwegs auf Einladung der Stiftung „bauen - wohnen - leben“: Expertenrunde mit Vertretern von Kommunen, Städtetag, Architektenkammern, Wohnungsbauunternehmen, Finanzwirtschaft, wohnwirtschaftlichen Verbänden, Medien und der Wissenschaft Vom stillen Kloster zum attraktiven Stadtquartier
Zum Auftakt der Exkursion besichtigten die Teilnehmer ein Stadtquartier in Köln. Es entstand aus einem früheren Kloster und vereint heute sozialen Wohnungsbau, Büroflächen und Gemeinschaftsräume. Der Wohnraum ist vollständig vermietet – rund zur Hälfte an Geflüchtete. Der KfW-prämierte Neubau gilt damit als Vorbild für integratives Wohnen. Architekt Peter Thein beschreibt das Quartier als „ein Projekt, das durch das gesellschaftliche Miteinander lebt“.
Aus Alt mach Neu: nachhaltiges Bauen
Weiter ging es über die niederländische Grenze in die Gemeinde Kerkrade: Hier entstanden im Rahmen des Projekts „SUPERLOCAL“ 113 Neubauwohnungen – und zwar zu 95 Prozent aus gebrauchten Materialien, die nach dem Abriss alter Gebäude recycelt wurden. „Das spart Baumaterial und CO2“, fasst Huub Engelen, Städtebauingenieur der Gemeinde Kerkrade, die positive Umweltbilanz zusammen. Doch damit nicht genug: Abfälle aus den Haushalten der neuen Wohnungen werden gezielt für die Herstellung von Biogas und Dünger verwendet.
Revolutionäres Verfahren zum Häuserbau
Das letzte Leuchtturmprojekt führte die Teilnehmer nach Eindhoven in die „3D Concrete Printing Factory“ von BAM und Saint-Gobain Weber Beamix. Die beiden Bauunternehmen arbeiten gemeinsam an revolutionären 3D-Druckverfahren für Häuser und Brücken – mit Erfolg: „Wir haben die erste gedruckte Brücke der Welt gebaut“, sagt Marco Vonk, Marketing-Manager bei Saint-Gobain Weber Beamix. Der Fußgängersteg in der Gemeinde Gement nahe Eindhoven wird bereits von der Öffentlichkeit genutzt.
 Auch die futuristisch anmutenden Häuser sind in Arbeit und sollen Ende 2020 fertig gestellt werden. Foto: Houben & Van Mierlo Architecten B.V.
Auch die futuristisch anmutenden Häuser sind in Arbeit und sollen Ende 2020 fertig gestellt werden. Foto: Houben & Van Mierlo Architecten B.V. Veranstaltungs-Symposien: "Städte für Menschen"
Akkordeon öffnen/schließen Jubiläumsveranstaltung 30 Jahre Schwäbisch Hall-Stiftung "bauen - wohnen - leben"
30 Jahre Schwäbisch Hall-Stiftung „bauen - wohnen - leben“ – dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, das Format „Städte für Menschen“ fortzuführen. Damit möchten wir Impulse für den Disziplinen-übergreifenden Diskurs zu wohnungs- und städtebaulichen Themenstellungen geben und mit einem ausgewählten Fachpublikum erörtern.
Impulspapiere der Stiftung "bauen-wohnen-leben"
In unseren Impulspapieren nehmen renommierte Expertinnen und Experten aktuelle wohnungsbaupolitische Themen auf und regen damit den interdisziplinären Austuasch an.
Klimawende im Gebäudebestand - wie Finanzströme transformative Kräfte entfalten können
Das weltweite Versagen bei der wirksamen Bekämpfung von
Ursachen (CO2-Emissionen) und Konsequenzen (z. B. Extremwetterereignisse) des
Klimawandels hat dazu geführt, nicht nur die Wirtschaftsaktivitäten einzelner
Branchen, sondern das globale Finanzsystem in seiner Stabilität zu gefährden.
Wie die Steuerung von Finanzströmen dazu beitragen kann, den für die Klimawende
bedeutenden Gebäudebestand zu transformieren, beschreibt Prof. Dr. Tobias
Popović von der Hochschule für Technik, Stuttgart in seinem Impulspapier.

Reich oder chancenlos? Warum Wohneigentum zur Vermögensgerechtigkeit beiträgt und die "Generation Miete" gesellschaftspolitisch brisant ist
Warum die Wohneigentumsquote hierzulade so gering ist und welche Auswirkungen dies auf die soziale und ökonomische Ungleichheit hat, stellt Prof. Dr. Oliver Lerbs von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein - Westfalen in seinem Impulspapier dar.
.jpg.transform/548/1763471284782/image.jpg)
Wie gewinnen Wohneigentumsbildung und Wohnungsbau wieder an Schwung?
Dieser Frage widmet sich der Beitrag von Prof. Dr. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln).
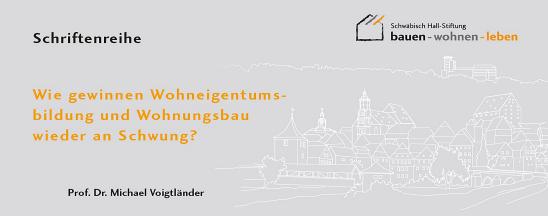
Auswahl von Projekten, die wir fördern:
Akkordeon öffnen/schließen Runder Tisch zum Thema "Suffizienzpolitik im Gebäudebereich" und ihr Beitrag für Klimaschutz, Ressourenschonung und gutes Wohnen
Gutes Wohnen und die Schonung von Ressourcen und Klima ist kein Widerspruch. Auf der lokalen Ebene zeigen Praxisbeispiele, wie innovative Maßnahmen zur Wohnraumschaffung umgesetzt werden, die ohne größere Material- und Energienachfrage einhergehen, z.B. Wohnraumagenturen, Umzugsprämien oder Anreize zur Aktivierung von Leerstand.
Allerdings werden die Potenziale solcher Suffizienzansätze in der Gebäudepolitik noch nicht gehoben.

Im November 2023 hat BPIE (Buildings Performance Institute Europe) deshalb Vertreterinnen aus Politik, Verbänden und Wissenschaft zu einem Runden Tisch in Berlin eingeladen und folgende Fragen diskutiert:
- Welche guten Suffizienzpolitiken gibt es im Gebäudebereich?
- Wie können sie in die Breite getragen werden?
- Wo liegen Hemmnisse und welche Potenziale gibt es ?
- Welche Politikempfehlungen lassen sich ableiten?
 Die Premiere des Films im Arena-Kino im Cinecitta in Nürnberg; Dezember 2022.
Die Premiere des Films im Arena-Kino im Cinecitta in Nürnberg; Dezember 2022. Welche Herausforderungen im Alltag warten und welche Lösungen bereits umgesetzt werden, haben eindrückliche Beiträge vom Wuppertal Institut für Umwelt, Klima, Energie und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gezeigt. Interessante Praxisberichte von der Wohnraumagentur in Tübingen, die Suffizienz in ihrer Beratung integriert, und dem studentischen Kollektiv des Collegium Academicum, die in Heidelberg ein Studentenwohnheim nach Suffizienzkriterien bauen und bewohnen, ergänzten die spannenden Fachbeiträge.
Erkenntnisse aus der Diskussion waren:
- Suffizienz sollte in allen Prozessen (von der Ziel- und Bedarfsfestlegung, über Planung und Umsetzung bis zur Nutzung) berücksichtigt werde, um die Klima-, Ressourcenschonungs- und auch sozialen Potenziale zu heben
- Wir haben weniger eine Wohnraumkrise, als eine Verteilungskrise.
- Kommunen sind Key: Themen wie Umzug, Verkleinerung, Aufteilung des Wohnraumes erfordert viel Kommunikation & ein gutes Beratungsangebote (mit Multiplikatoren!)
- Gut designte Lösungen können Sorgen überwinden helfen und unsichtbaren Wohnraum nutzbar machen
- Förderprogramme sollten Suffizienzaspekte besser abbilden und unterstützen
- Suffizienz bedeutet genug - nicht zu wenig, nicht zu viel und birgt große Potenziale für eine höhere Lebensqualität
Akkordeon öffnen/schließen „Wie wollen wir leben und wohnen wenn wir älter sind?“ - Ein medienpädagogisches Filmprojekt der Landesmediendienste Bayern
Wie wollen wir leben und wohnen wenn wir älter sind? Mit diesem Thema haben sich Jugendliche über ein Jahr lang in Filmberichten und Interviews auseinandergesetzt.
In dem medienpädagogisch begleiteten Projekt berichten die Jugendlichen über unterschiedlichste Wohnformen, zum Beispiel Lebensgemeinschaften oder Tinyhouses, den Umgang mit Einschränkungen – selbst getestet im "Altersanzug" G.E.R.T – und über Möglichkeiten der Teilhabe im Alter, zum Beispiel bei „Omas for future“ in Forchheim.
Straßenumfragen, ein Fach-Interview mit der Vorständin für Gesundheit und Teilhabe des Diakonischen Werks Bayern, Sandra Schuhmann sowie Statements der Jugendlichen zu ihren Vorstellungen und Ängsten zum Alter runden den Film ab.
Der ca. 50-minütige Film steht unter diesem Link online zur Verfügung.
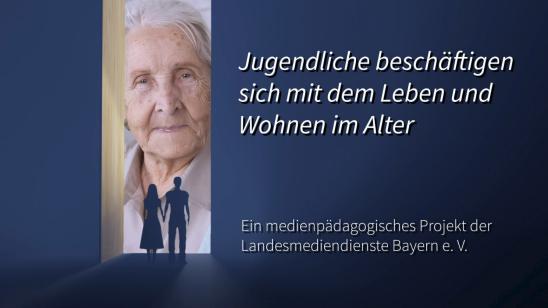
 Die Premiere des Films im Arena-Kino im Cinecitta in Nürnberg; Dezember 2022. (Quelle: Landesmediendienst Bayern)
Die Premiere des Films im Arena-Kino im Cinecitta in Nürnberg; Dezember 2022. (Quelle: Landesmediendienst Bayern) Medienpädagogische Unterstützung:
Andres Müller (Mag. Medienwissenschaften, Psychologie und Pädagogik), seit 2006 im Einsatz als Medienpädagoge. Seit 2009 Trainer und Dozent u.a. für die ARD-ZDF-medienakademie. Außerdem Berufsschuldozent in Bayern, eigene Produktionsfirma und Kameramann, On-Camera-Coach. Leitung des Projektes, Regie und Kamera. Leitete alle Treffen und Dreharbeiten.
Pia Wollny, Projekt-Assistenz und Kommunikation mit den Jugendlichen. Unterstützung bei vielen Drehs und allen Treffen
Hartmut Altenpohl, Postproduktion
Gerhard Engel: Ideengeber, Geschäftsführer der Landesmediendienste Bayern
Akkordeon öffnen/schließen Projekt „Wohnen im gewerblichen Leerstand“ des Adapter e.V., Stuttgart
Der Verein will temporären gewerblichen Leerstand nutzen und in Form eines Pilotprojektes neue gemeinschaftliche Wohnformen in der Alltagsrealität erproben. Gefördert wurde die Entwicklung und Produktion eines Wohnmoduls als Kleinserie. Zum ersten Mal aufgebaut wurde das Paneel-System in der Neckarspinnerei in Wendlingen. Ziel ist es, das momentan leerstehende Areal in zwei Phasen innerhalb der nächsten zwei Jahre bewohnbar zu machen.
Bei Adapter gibt es mehr Informationen zum Nachlesen.
Akkordeon öffnen/schließen Forschungsprojekt „über_dacht“ der Universität Stuttgart
Gegenstand der Untersuchung sind die Überbauungsmöglichkeiten von bestehenden Verkehrsbauwerken für Wohnzwecke. Mit dem Forschungsprojekt soll grundlegendes, planungsrelevantes Wissen über die Nachverdichtungspotentiale urbaner Standorte ermittelt werden, die bislang nicht für das Wohnen genutzt wurden. Die Recherche von relevanten Überbauungsstandorten in den Ballungszentren von München, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Köln ist abgeschlossen. Insgesamt wurden rund 40 Standorte ausfindig gemacht. Aktuell erfolgt der letzte Arbeitsschritt einer Machbarkeitsstudie zum Standort McGraw Graben/ St.-Quirin-Platz in München Giesing.
Mehr Informationen zu über_dacht gibt es bei Zukunft Bau.
Akkordeon öffnen/schließen Architekturführer „Frankfurt 1990 – 1999“
Fünfter Band zur Architekturgeschichte Frankfurts ab dem Jahr 1945; mehr Informationen und Einblicke ins Buch gibt es bei OPATZ und OPATZ.
Förderantrag zum Ausfüllen & Jubiläumsbroschüre

Sie möchten einen Förderantrag stellen?
Das Kuratorium der Stiftung
- Vorsitzender: Mike Kammann, Vorsitzender des Vorstands der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall
- Dr. Cornelius Riese, Vorsitzender des Vorstands der DZ BANK AG, Frankfurt am Main und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall
- Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen-GdW
- Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Berlin
- Detlef Raphael, Beigeordneter des Deutschen Städtetages a.D., Umwelt und Wirtschaft, Berlin
- Christine Scheel, Mitglied des Deutschen Bundestages a.D.
- Holger Schwannecke, Generalsekretär, Zentralverband des Deutschen Handwerks, Berlin
Die Geschäftsführung der Stiftung
- Geschäftsführer: Wim Buesink, Leiter Politik und Gesellschaft, Bausparkasse Schwäbisch Hall












